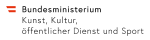MITGLIEDER
Text von:Sabine Nikolay
LET IT BE – ein Ausschnitt
Mein Vater war in technischen Dingen überhaupt nicht versiert. Zeit seines Lebens besaß er nichts als einen alten Portable-Kassettenrecorder, der bis zum Tag seines Todes am Fußende des elterlichen Bettes unter einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher stand. Damit hörte mein Vater Kassetten. Manche kaufte er sie selber: Klassische Musik von Mozart und Beethoven, aber auch Klassiker von Joan Baez, Bob Dylan oder den Beatles. Viele Kassetten wurden ihm von Bekannten und Freunden von Platten überspielt. Die selbstfabrizierten Kassetten machten den Großteil der Sammlung aus. Ich lernte schnell, die Handschriften der Schenker zu unterscheiden und begann, die Menschen nicht nur nach ihrem Auftreten und ihrem Äußeren zu beurteilen, sondern auch danach, welche Literatur und Musik sie mochten.
Eine der wenigen „Originalkassetten“, die mein Vater gekauft hatte, war „Let It Be“ von den Beatles, damals ein neues Album - eine wichtige Platte, dokumentierte sie doch die Trennung der legendären Band. Ich entdeckte die Beatles am Ende einer Ära und hatte keine Ahnung von der Bedeutung dieser Band – aber ich liebte die Musik. Damit hatte ich eine neue Beschäftigung: Täglich nach der Schule, sobald ich mein dürftiges Mittagessen, bestehend aus einem belegten Brot und einem Stück Schokolade, verzehrt, sobald ich das Geschirr vom Vortag gewaschen, die Betten gemacht und eingekauft hatte, legte ich mich auf das Bett meines Vaters und schob die Beatles-Kassette in den Recorder. Nachmittage lang lag ich angestrengt lauschend, summte die Melodien mit und wagte mit der Zeit zaghaft, englische Worte zu formen. Bald lag ich dort mit Stift und Papier, schrieb die Texte so wie ich sie zu verstehen glaubte nieder und schlug die Vokabel in einem dicken Wörterbuch nach. Auf diese Weise übersetzte ich alle Texte des Albums.
Damit fertig, begann ich andere Musik zu hören, doch nichts war so gut wie die Beatles.
Zuzuhören wurde jedoch bald zu wenig – und so wagte ich mich also an die Englischen Bände, scheiterte jedoch an der Sprache. Mein Englisch war noch nicht gut genug. Einen Nachmittag lang kämpfte ich mich durch einen Band mit Gedichten von Sylvia Plath – dann senkte ich erschöpft den Kopf und gab auf. Nach Minuten des Still-Liegens öffnete ich die Augen und entdeckte etwas Neues: Am Fußende des Bettes lag auf dem untersten Regalbrett ein Stapel Magazine, der mir nie zuvor aufgefallen war. Ich streckte die Hand aus und fuhr andächtig über die glatte Oberfläche des Umschlages aus Hochglanzpapier. Unter meiner Hand befand sich eine Werbung für eine Uhr so teuer wie ein neues Auto. Ich griff zu, zog das Magazin an mich heran und drehte es um.
“Penthouse” las ich. Die Abbildung unter dem Titel trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Mit der nackten Dame hatte ich ein Geheimnis meines Vaters entdeckt.
In diesem Moment setzte George Harrisons Gitarre ein, und einige Takte später begann John Lennon zu singen: „I’ve got a feeling, a feeling deep inside, oh yeah.…”
Das Bild verschwamm vor meinen Augen. Alles Böse, vor dem mich meine Mutter gewarnt hatte, hielt ich nun in Händen. Ich erinnerte mich an Situationen auf Tankstellen und in Geschäften, als sie mich umgedreht und „schau’ nicht hin!“ oder „warte draußen auf mich“, geflüstert hatten – und nun fühlte ich das Böse hier, in meinen Fingern.
„I’ve got a feeling, a feeling deep inside…”
Die Wohnungstür fiel mit lautem Krachen ins Schloss, ich schob das Magazin zurück, drehte die Musik ab und lief schnell in mein Zimmer, wo ich die Nase in meine Schulhefte steckte um nach ein paar Minuten möglichst unauffällig in der Küche zu erscheinen und die Stimmung zu sondieren.
Am folgenden Tag nahm ich den Platz am Fußende des Bettes erneut ein. Diesmal griff ich gleich nach dem Magazin, drehte es um und bemerkte sofort, dass es eine andere war, deren Brüste in meinen Händen zitterten. Diese Frau hatte brünettes Haar während die Dame von gestern hellblond gewesen war. Ich durchsuchte den Stapel, um sie wiederzufinden. Es war unmöglich. Vor mir ausgebreitet lagen verschiedene Frauen, die alle gleich aussahen und lediglich durch die Haarfarbe eindeutig von einander zu unterscheiden waren – doch innerhalb der Blonden, Schwarzen und Rothaarigen war es fast unmöglich, eine bestimmte herauszufinden.
Tagelang betrachtete ich nackten Frauen, lernte, Scham und Aufregung, die mich jeden Tag aufs neue überfielen, zu beherrschen. Nach ein paar Wochen betrachtete ich sie ganz ungeniert, legte die ausfaltbaren Mittelteile nebeneinander und verglich die Frauen, suchte nach Ähnlichkeiten und Unterschieden in ihren intimsten Bereichen – bis ich dieses Spiel satt hatte.
Also musste ich die Hefte durchlesen. Es war nicht gerade Literatur, was in diesen Penthäusern, Playboys und Mayfairs zu lesen war, doch ich verstand es, trotz der englischen Sprache. Langsam arbeitete ich mich durch das erste Heft, das Wörterbuch neben mir. Am Ende dieses Heftes entdeckte ich einen Cartoon:
Wicked Wanda war eine beeindruckende Blonde mit enormen Brüsten und einem großen roten Mund. Ihre Kleidung bestand aus nichts als einem engen Mieder, einem Höschen und hochhackigen Stiefeln. Sie lebte in einer Burg, war anscheinend reich und hatte nichts zu tun, außer andere Menschen zu quälen oder sie zu verführen. Ihr ständiger Begleiter war ein alter, kahlköpfiger Diener, genannt Eggbonce (was ich, mangels einer befriedigenden Antwort aus dem Wörterbuch, mit „Eierkopf“ übersetzte), der mich an die Gestalt des Methusalix aus den Asterixheften meiner Kindheit erinnerte. Eggbonce hatte jedoch keinen Zaubertrank und konnte seiner Herrin wenig entgegensetzen.
Sie quälte ihn auf jede nur erdenkliche Weise.