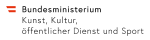MITGLIEDER
Text von:Andrea Drumbl
Auszug aus „Die Vogelfreiheit unter einer zweiten Sonne, weil die erste scheint zu schön“
In diesem Jahr brach der Sommer alle Rekorde. Der Juni war so heiß und trocken wie noch nie zuvor. Der Himmel war immer blau, und jeden Tag stieg aufs Neue die Sonne auf. Gleißend und heiß, wie für die Unendlichkeit, konnte sie so gänzlich in einen hineinsinken. Nach einem schweren süßen Frühling, in dem alles Gras und Grün so üppig voll aus der Saat ins Kraut geschossen war, brach die Hitzeperiode herein, die Sonne brannte vom Himmel, und eine große Mattigkeit mit einer genauso großen Erschöpfung auf den Straßen senkte sich über die ganze Stadt. Auf den Straßenrändern verdorrten die Blumen im Gras, und auf den Feldern vor der Stadt stand das Getreide dürr und halbreif. Nachts schien es in den Häusern noch heißer und schwüler zu sein, man sehnte den Regen richtig herbei.
Den ganzen Juli über blieb der Himmel drückend blau, und die Menschen dieser Stadt zeigten sich mit in die Haut gebrannten Sonnenstichen auf den staubigen Straßen, wo die lasche Sommerlichkeit mit ihrer stumpf stehenden Hitze unerträglich lastete. Erst im August setzte der Regen ein, und es wurde schlagartig dunkler und kälter, mit einem blassen, vom Wind verwehten Himmel. Das Laub fiel von den Bäumen, und über dem Boden hing eine nebelverhangene Düsternis. So verging der Sommer. Die Blumen schossen weiterhin in die Höhe und in die Breite und wuchsen in Hülle und Fülle. Letzte Vögel sangen im Gebüsch, aber nicht für Günter und nicht für Piotr, nicht für Susana und auch nicht für Felix. Für sie, so könnte man sagen, leuchtete der Mond wie eine fremde Sonne.
Draußen dunkelte es jetzt, dunkler, immer dunkler wurde es und kalt, und im Lampenlichterschein riss es das Laub vom Baum, und die Blumen hingen traurig welk mit ihren Köpfen im ausgehungerten Gras. Der ganze Tag war voll von durch die Lüfte wehenden, schwebenden, von durch die Lüfte fallenden Blättern.
In diesem Jahr fielen die ersten Herbstnebel bereits im September über die Stadt und hängten sich wie eine Schaumkaskade über den Fluss. Es roch nach Fäulnis, und über dem Wasser tief unten im Graben schwirrten immer noch schwarze Insektenschwärme. Aus dem Wald mit seinen schwarzen Nadeln und grünen Zapfen kam der rasselnde Ruf eines Vogels, oben hängte sich ein Stück müder Himmel auf und unten am Boden lagen die Wurzelknollen wie grausam verknöcherte Fingergelenke. Die Luft schwirrte noch von Fliegen, dunkel dahin taumelnde Insekten mit hängenden, pendelnden Beinen, fleischig und doch so federleicht. Die Nächte waren warm für September und taghell vom Mond, der die meiste Zeit vom Himmel knallte und mit seinem grellgelbgrellen Licht die Straßen unter sich beschien. Es waren der Himmel, diese Nächte im September, diese letzten Feste, diese späten Feiertage.
Aber der September zeigte sich auch als schwarzer Monat. Vier Menschen starben unabhängig voneinander innerhalb weniger Tage und im Umkreis von nur wenigen Kilometern.
Sie starben allesamt von eigener Hand.
[…]
In diesen Tagen also, da legte sich Piotr mit dem letzten Rest Atem in seiner Lunge unter den Zug, während andernorts Günter, zu seinem letzten Sprung Leben in den Tod ansetzend, im braunen Laub auf der Straße den Asphalt aufsuchte, noch weiter weg Susana in ihrem letzten Kampf im Totentanz alles Leben in ihrem Blut erstickte und Paula den am Strick im Würgegriff erhängten Felix in die Erde vergrub. Was zurückblieb, war einzig diese eine große Schuld zwischen Hirn und Haut und Haut und Haar. Damals wie heute wie früher oder später und immer noch. Aber was ist das bloß, wenn Menschen das Leben lassen, weil sie es nicht mehr ertragen, es abgrundtief hassen? Es ist die große Tragödie am Ende des Stücks.
[Aus Die Vogelfreiheit unter einer zweiten Sonne, weil die erste scheint zu schön - Edition Atelier, Wien2013, S. 12f, 49]