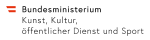MITGLIEDER
Text von:Daniel Zipfel
Die Nachbarin
Die Nachbarin hatte ein Gewehr. Unter dem Scheunentor floss zäh die Nachmittagssonne durch, beleuchtete viel zu hell den Staub, den unsere Stiefel aufwirbelten, als wir die Zigaretten austraten. Der Geruch des Heus stieg mir vertraut in die Nase, schon ein Leben lang roch es hier gleich. Draußen, jenseits der Holzwand, zirpten die Grillen. Ich hatte bereits den ganzen Tag gezögert, die ganze Woche, den ganzen Monat.
„In der Scheune“, hatte die Nachbarin gesagt, „nur dort, sonst drehen die anderen durch, wenn sie das Blut sehen.“
Viel zu lange hatte ich gewartet, aber jetzt musste etwas getan werden. Die Nachbarin konnte gut mit ihrem Gewehr umgehen, schon immer konnte sie das. Früher hatte ich oft beobachtet, wie sie auf Dosen schoss und den Lauf nachher putzte, damit ihre Mutter nichts merken würde. Schießpulver und Heu, davon hatte es hier immer genug gegeben. Nur die Grillen, die schienen früher leiser gewesen zu sein.
„Muss ich ihn halten?“ fragte ich.
„Ich fürchte ja“, sagte sie.
Der Staub legte sich in meinen Hals und auf den alten Mantel. Ich würde ihn abklopfen müssen, vielleicht sogar waschen lassen.
Ich hatte den Mantel getragen, als ich vor acht Jahren aus der Stadt zu Besuch gekommen war, und Julia, die extra herübergelaufen kam, hatte gelächelt, wie gut ich darin aussehe. Soviel älter. In der Wiese um uns herum zirpten die unsichtbaren Grillen, die wir als Kinder gejagt hatten, bis unsere Mütter uns aus dem Gras hereinholten, was wir denn da draußen machen würden, zusammen, und jetzt drehte ich mich vor Julia in meinem neuen Mantel durch die warme Luft und antwortete mit ein, zwei erprobten Bemerkungen, die mir drei, vier gemeinsame Nächte einbrachten, bevor ich zurück fuhr und mich nicht mehr meldete.
Ich kam erst wieder zu Allerheiligen, weil mein Vater meine Hilfe brauchte auf dem Friedhof. Die Grillen waren längst alle tot und der Herd wurde wieder öfter angeheizt. Wir saßen im Zwiebelbuttergeruch beim Abendessen und redeten nicht über meine Mutter, als auf einmal Julia in die Küche stürmte. Sie blieb einen Moment lang vor unserem Tisch stehen, und der heilige Florian blickte von seinem Winkel direkt auf ihren hochroten Kopf, die ringenden Hände und ihre Lippen, die sie stumm bewegte, während sie von mir zu meinem Vater und zurück blickte. Schließlich holte sie tief Luft, deutete mit dem Zeigefinger auf mich und schrie, mir sei das Du-Wort entzogen. Hiermit. Dann drehte sie sich um und lief davon, knallte die Tür ins Schloss, mit aller Wucht, sodass die guten Suppenteller im Küchenregal zitterten, in deren grünblauer Glasur die Mitgift der Großeltern steckte. Mein Vater hob eine Augenbraue, kraulte den Hund hinter den Ohren und aß dann schweigend weiter. Im Winter, meinte er nach einer Weile, wolle er Tannenzweige auf das Grab legen, da würde ich ihm auch helfen müssen.
Vom Scheunentor hatten sich Spinnenfäden in meinem Mantel verfangen. Ich zog sie angewidert weg.
„Ich war viel zu selten da. Der Hund muss mich vermisst haben.“
Die Nachbarin schwieg.
„Hat man gemerkt, dass er mich vermisst?“
Sie wiegte den Kopf. Wir sahen eine Weile dem Staub zu, beide auf denselben Punkt, und sie rückte die Mütze zurecht, die ich ihr einmal mitgebracht hatte, zur Versöhnung.
Sie war zufällig da gewesen, wegen der Eier oder der Milch. „Schau her“, hatte ich zu meinem Vater gesagt, „wie gut die der Julia passt.“ Im nächsten Moment hatte mich ihre breite Handfläche ins Gesicht getroffen, und durch das Pfeifen in meinem Ohr drang das damals bereits zahnlose Lachen meines Vaters. „Meine Kinder“, kicherte er, „meine Kinder“, und dazwischen ihr Brüllen. „Für dich gibt es keine Julia, hast das schon wieder vergessen, für dich gibt es nur eine Frau Nachbarin!“
Neben unseren Stiefeln kam ein leises Winseln vom Scheunenboden. Die Nachmittagssonne und der Staub fielen dem Hund auf die Schnauze.
„Vor ein paar Jahren hat er mich gebissen“, sagte ich und blickte weg, „Vielleicht hat er mich nicht wiedererkannt, jedenfalls habe ich ihn getreten, viel zu stark in die Seite, und ihn tagelang ignoriert. Dann bin ich wieder gefahren.“
Nachdenklich stocherte die Nachbarin mit dem Lauf des Gewehrs im Heu herum. Draußen wurden die Grillen wieder lauter.
„Keine Sorge“, meinte sie schließlich, und beim Entsichern lächelte sie, „Der hat gewartet. Immer nur auf dich.“
***
Die Kurzgeschichte „Die Nachbarin“ erschien 2012 in der Zeitschrift des Österreichischen SchriftstellerInnenverbands