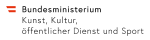MITGLIEDER
Text von:Carolyn Amann
„Neu Amerika“ (Auszug)
Der Himmel ist tiefblau. Soweit man sehen kann, erblickt man keine Menschenseele. Nur Landschaft. Meine Schuhe versinken im Dreck. Der Acker ist von einem Kanal umzäunt, einem Rinnsal, das weder fließt noch steht. Eher suppt es. Man kann das Wasser durch die Gräser kaum erkennen und sieht erst, wenn man drinnen steht, wie tief der Morast ist. So waten wir durch den Wiesenkanal hinüber zum Acker, der brach vor uns liegt und durch grobkörnigen Erdstücke eine unwirkliche Mondlandschaft bildet. Dunkelbraun, feucht und fest. Es ist ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Die Sonne hat trotz fortgeschrittenem Herbst noch Kraft und bescheint unbeirrt den Acker. Knapp über der offen liegenden Erde wimmelt es vor Insekten. Es scheint, als hätten alle Flügel bekommen, jeder Käfer, jede Made. Alles schwirrt den klirrenden Novembertagen entgegen, aus Hoffnung just hier noch ein neues Leben zu beginnen. Die Erde bekommt dadurch etwas Fauliges. Später wird die Kälte sie alle töten.
Wo ist die Grenze? Ich habe bereits mehrmals gesagt, dass ich müde bin, nicht schritthalten kann. Mir surrt der Kopf vom ganzen Ungeziefer. Sie fliegen mir immerzu ins Gesicht. Hauchdünne Fliegen, die man fast einatmet, und schwere Brocken, die aufprallen wie Luftdruckgeschoße. Meine Füße sind längst nass und meine Schuhe bereits vollgesogen. Wenn man nicht aufpasst rutscht man von den Grasinseln in den Matsch ab. Du bist ein paar Meter vor mir, gibst die Richtung an. Du redest, doch ich kann dich nicht verstehen, du bist zu weit weg. Ich muss weitergehen. Hinsetzen geht hier nicht. Alles ist nass. Du hast dich umgedreht und ruderst mit den Armen, rufst nach mir. Meine Geduld ist nun am Ende. Die Sonne blendet und ich schwitze. Jeder Meter wird durch die vollgesogenen Schuhe mühsamer. Mit meinem nächsten Schritt rutsche ich ab. Ich gehe in die Knie, stütze meinen Fall mit meinen Händen. Meine Finger tauchen zwischen den Gräsern ab. Sie sinken ein in weiche, losgelöste Erde. Mein Kinn wird nass.
Wo die Grenze ist, habe ich dich gefragt. Du hast daraufhin etwas von angrenzender Wiese, die keinesfalls nass ist, erzählt, nicht unweit von hier. Wir müssten sie eigentlich schon erreicht haben. Du verstehst auch nicht, warum sich der Wasseracker so weit zieht. Es kann sich nur mehr um Meter handeln. Es scheint, als könntest du das Ende schon sehen – wo das Grün etwas heller wird, die Grasfetzen lichter. Dort wo die Erde brach liegt. Das ist für mich aber schon über der Grenze. Ich bin jetzt ganz nass. Ich friere und bis nach Hause ist es über eine Stunde Fußmarsch. Vor uns liegt nur diese Mondlandschaft. Selbst an der Mündung wohnt niemand. Wir sind vom Nirgendwo weiter ins Nirgendwo hineingelaufen. Wie unnütz. Die Nässe verbreitet ein Gefühl auf meinem Körper, als könnte ein Windhauch ihn jederzeit in Stücke reißen. Hoffentlich bleibt dieses Lüftchen aus. Ich weiß nicht, ob ich schreie oder weine. Wahrscheinlich sage ich nichts.
Ich bin ganz außer mir. Meine Hände bedecken mein Gesicht, deine Hände meinen Kopf. Durch die Finger hindurch sehe ich Risse an den Wänden. Sie ziehen sich von der Ecke über die gesamte Wand herab. Ästeln sich wie Bronchien in immer feinere Stränge aus. Ich folge den Rissen mit meinen Augen. Sie sind das einzige, was ich sehe. Ich habe vergessen, dass wir uns draußen aufhalten. Ich habe mich vergessen und mach meiner Inneren Zermürbtheit platz. Mit weit aufgerissenem Brustkorb. Alles was mich auffrisst. Das Zuviel an Magensäure, dass damit beginnt, den eigenen Magen zu zersetzen und nach und nach ein Loch in sich selber frisst. Das alles kehrt sich nun nach außen. Ich kann es nicht mehr eindämmen. Jetzt muss es erst mal raus. Die Wände, weißgekalkt, sind die des Bahnhofs. Die Bank, auf der ich sitze, öffentlicher Warteraum. Ich weiß nicht, ob sonst noch wer da ist. Im Sekundentakt brechen Schreie aus mir hervor. Wimmern und Japsen. Dazu zuckt mein Körper. Ich werfe mich auf die eine und dann auf die andere Seite, egal ob ich noch auf der Wartebank lande oder nicht. Du versuchst mich festzuhalten. Mein Gesicht schneidet Grimassen. Meine Hände halten es fest. Die Augen habe ich auf die Risse gerichtet. Ich habe dich gewarnt und ich habe gesagt, dass die Grenze überschritten ist. Ich sage das ja nicht umsonst. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Jetzt müssen wir warten, bis ich mich beruhigt habe.
Es beginnt in meinen Armen. Müdigkeit breitet sich in ihnen aus und lässt sie wie leblos herabsinken. Als wäre da keine Notwendigkeit für die Muskeln sich weiter anzuspannen. Meine Finger lösen ihren Griff. Meine Gesichtsmuskeln sind erschöpft und mein spastisches Grinsen verschwindet. Meine Augen senken sich zum Steinboden hin. Ich höre den Wind, wie er durch den Warteraum weht. Er hebt die gegenüberliegenden Türen von Bahnsteig und Ausgang leicht an und entlockt ihnen ein Quietschen. Es ist immer noch heute. Mein Gesicht liegt auf deinem Schoß. Du trocknest es mit deinem Pullover. Wischst mir den Rotz von der Wange, die Spucke vom Mund. Dann beginnst du damit, mich langsam aufzuklauben. Zuerst meine Arme, dann meine Beine. Du hebst du mich hoch und legst mich auf die Rückbank eines Autos. Ich schlafe ein.
Das Auto hat uns zurück in die Hütte gefahren. Als ich aufwache liege ich in unserem Bett. Ich kann die Nacht durch die Fenster sehen. Ich muss einige Stunden geschlafen haben. Es sieht so aus, als ob du immer bei mir gewacht hättest. Doch ich glaube das täuscht. Jedenfalls bist du da und drehst dich zu mir als ich aufwache. Die Nachttischlampe ist an und ich sehe dein Gesicht. Für mich ist es selbstverständlich, dass du dich um mich kümmerst. Es liegt in deiner Verantwortung. Du willst Vertrauen und hier hast du es. Du willst Gehorsam und du kriegst ihn auch. Das Loch in meinem Magen schmerzt. Du küsst mir die Stirn. Ich hasse dich so sehr.
(Erschienen in: Miromente. Zeitschrift für Gut und Bös. Hg.: Mörth, Wolfgang. Gabriel, Ulrich. Heft: 55. Dornbirn: März 2019)