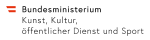MITGLIEDER
Text von:Barbara Aschenwald
Die Augen der Fische
Es gibt einen Weg der keiner ist und daneben ist ein Bach. Der Bach ist nur klein und in ihm liegen umgestürzte Bäume und es wabert helles Wassergrün darin mit runden Blättern und darauf schwimmen Blasen aus Schatten, die dunkles Rund auf den Grund zeichnen.
Wir sehen die Pflanzen und das Holz und das Rund und in dem Wasser sind wie Zeichen oder Striche kleine Fische wie eine Blase aus Mücken und genau so schnell.
Sie spritzen in alle Richtungen davon, wenn etwas ins Wasser fällt, sie versprengen. Der Weg neben dem Wasser ist nur ein Trampelpfad im Gras. Das Gras sieht aus wie die Haare eines Neugeborenen, dabei ist es vom letzten Jahr, trocken und gelb.
Und wer über dieses Gras geht der kommt zu blauen Schloten, die bedeckt sind von weißem Plastik. Es sieht aus wie Stoff und ist ein Netz.
Da, wo der Wind das Netz aufgehoben hat haben die Hasen die Schloten gefressen.
Sie sind am Rand so, wie das Gras, papierern und trocken und drinnen nur blau.
Und der Wind geht durch die Weiden mit den vom Schnee abgebrochenen Ästen, als seien sie nicht da.
In der Mitte des Feldes ist ein Haus, das Feld braucht es aber nicht, denn es wohnt niemand da. Es kommen Maschinen und liefern Mist und pflügen und ernten den Mais im Herbst, es kommt ein Mensch mit den Maschinen. Nur das.
Auf dem Weg gehen Leute mit Hunden, Leute mit Kindern, Leute mit Stöcken und Leute mit nichts als sich selbst. Ich bin auch da und will nicht alleine sein und die Fische sind im Wasser und haben fremde Augen.
Wer, der Angst vor dem Tod hat versteht dieses Leben?
Ich verstehe die Augen der Fische nicht und der Wind geht durch die Dinge, als wären sie nicht.
Es ist Frühling und der Frühling ist der Tod des Winters.
Welche Sonne steht über uns? Im kleinen Bach stehen die Fische und bewegen sich nicht, nur die Schwanzflossen als wäre es die Strömung des Wassers.
Die Bläschen auf der Oberfläche blitzen.
An dem Wegesrand, der keiner ist, stehen Zirben. Sie sind alleine auf dem Feld und sie stehen noch da, weil sie etwas wert sind. Die Fichten hat man lange gefällt.
In der verlassenen Scheune liegt das Heu vom Sommer vor achzig Jahren.
Es ist schon fast Staub.
Im vom geschmolzenen Schnee matschigen Boden sind frische Traktorspuren, auf dem nassen Stoppelfeld, wo noch einzelne Maiswimpel an vergessenen Halmen wehen, liegt dampfende der Mist, um den schadhaften Boden auszubessern.
Entlang des Weges geht jemand, dem ein Kind auf einem kleinen Fahrrad folgt. Das Kind trägt ein blaues Jäckchen und keine Mütze, weil es schon so warm ist, aber blaue Gummistiefelchen wegen des nassen Bodens.
Überall sind tiefe Pfützen. In ihnen spiegelt sich das hohe Wasserblau des Himmels.
Und unter dem gefrorenen Boden klopfen die Gnome.
Die Bäume spitzen schon die Ohren und die Vögel werfen das helle Lied des Windes zurück zu ihm. Und das Kind ist der Frühling des Lebens.
Jemand geht entlang des Weges und die Fische sind im Wasser.
Jemand hat das Kind zur Welt gebracht. Und jemand muss ihm zu essen geben.
Die Sterne sind am Himmel hinter dem Blau, man sieht sie im Blau nicht weil sie dort verschwinden wie das Licht im Licht verschwindet.
Die Stiefel des Kindes sind nass. Versteckt am Hundeweg zum Wasser steht die erste gelbe Blume des Jahres in der Erde. Der wilde Wind geht durch die Dinge als wären sie nicht.
„Lasst mich doch in Ruhe mit allem“ denkt sich jemand. „ich bin schon froh wenn ich das Essen auf den Tisch bringe und meine Rechnungen..“
„Mama, ich stecke fest“ schreit das Kind, das mit dem Vorderrad absichtlich in den Schlamm gefahren ist. „Ich stecke fest!“
„Ich komme ja“ sagt jemand.
Am Ende der Welt fliegen die Fetzen. Wie schlecht doch Leute leben müssen!
Jemandem ist zuhause im Ofen das Essen verbrannt. Am Ende der Welt? Wirklich?
Es gibt hier zu essen und eine Tür, die man schließen kann und auch Wärme.
Der Bach ist kalt, es ist Frühling.
Was wird nur aus mir denkt jemand. Ich höre die Vögel nicht mehr singen, aber ich habe es warm und gut.
Jemand ruft nach dem Kind, dass es herkommen soll.
Das Kind wirft ein Hölzchen zu den Fischen, denn wenn sie sich nicht bewegen, kann es sie nicht sehen.
In der Scheune schneidet das Licht den Staub in Scheiben und die feinsten Teichen schwirren und verschwinden in diesem Licht.
An der Tür ist ein Schloss, denn weil niemand mehr hier wohnt soll keiner hineinkommen. Um das Haus ist ein Gitter.
Die Felder sind etwas wert. Und der Boden wird besser.
Aber es kommt nur ein Mensch mit einer Maschine. Es braucht nicht mehr als einen.
In diesem Jahr wird der blaue Lauch nicht geerntet sondern untergepflügt.
Die Hasen fressen das, was noch aus der Erde ragt.
„Jetzt komm, komm, komm, komm doch!“ ruft jemand dem Kind zu.
Es gibt ein Zuhause. Dort ist es warm, weil man es heizen kann und das Holz bezahlen.
Die Fenster des alten Hofes sind zerschlagen und vor der Tür steht ein Gitter. Aber die Spitzenvorhänge sind noch da. Wer könnte dort sein, wenn er Holz sammelt?
„Warte auf mich Mama!“ ruft das Kind. „Jetzt warte doch!“
Endlich ist es Frühling.
Das Ende der Welt ist hier um die Ecke. Dort liegen die Kinder im Schlamm und haben Hunger.
„Lasst mich in Ruhe, alle in Ruhe!“ denkt jemand sich „ich will nichts hören von der Schlechtigkeit der Welt und ich will mir nichts anhören, zu dem ich dann eine Meinung haben soll, lasst mich in Ruhe! Ich bin schon froh wenn ich meinen Tag rumkriege!“
„Mama, warte, warte, warte, warte, warte!“
Zuhause die Küche ist schmutzig und die Töpfe stapeln sich und auf dem Teppich sind die zertretenen Blaubeeren. Aber die Laden sind voll mit Reis und Mehl und im Topf ist Brot. Es gibt ein Konto und eine Versicherung und ein Haus und ein Auto und es gibt eine Küche, die jemand gehört. Zwei Katzen sind da und sie haben auch keinen Hunger.
Das Gras ist trocken und gelb und raschelt unter den Schritten.
„Schau mal Mama, da ist ein Fisch!“ sagt das Kind und es kommt jemand. Am Hundeweg ist es mit dem Fahrrad stehengeblieben und zeigt in den kleinen Bach, wo etwas langes, dunkles langsam fächelt. Jemand kneift die Augen zusammen.
Das alles kann doch jeder andere auch erleben, wozu braucht es da mich? Jemand schaut in den Wind. Wie wenig unterschiedlich unsere Leben doch sind denkt sie sich.
In den Zeitungen steht dass es schlechter wird. Es wird schlechter und bestimmt noch schlechter. Und im Fernsehn sagen sie das auch. Und das Gras und der Staub und das Licht sind dieselben. Aber um die Ecke fliegen die Fetzen und die Kinder liegen im Schlamm und haben Hunger. Warum tut das nicht weh? Weil wir unsere Ruhe haben wollen.
Das Auto ist kaputt gewesen, das war sehr teuer, es war die Kupplung, das muss man bezahlen. Das Kind muss in den Kindergarten, wer bezahlt die Versicherung, wer den Strafzettel, das Telefon, die Lebensmittel, wer bezahlt das Leben, wer bezahlt denn dieses geschenkte Leben, wer die Grundsteuer, das Internet, die Reparaturkosten, die Socken, das Katzenfutter, den Arzt, das Benzin, die neuen Kinderschuhe, der wächst ja so schnell, ich brauche ja selber nichts.
Der Weg führt weiter den Bach entlang. Im glitzernden Licht der Bläschen ist alles noch hell und das Kind fährt zu jemandem, der wartet. Zuhause ist das Essen verbrannt aber es gibt etwas anderes dafür, weil etwas anderes da ist.
In dem Bach schwirren die Fische und sie haben Augen, die so leer und tief sind wie das Wasser. Niemand kann sie verstehen, und jemand wäre lieber tot als durch ihre Augen das zu sehen, was sie sehen.
Die Augen der Fische sind das Bewusstsein der Fische. Sonst haben sie keines. Keine Vernunft der Welt kann die Augen der Fische verstehen.
Und das Licht und die Wärme brechen Ende Februar langsam das Eis.
Ich habe Angst vor der Kälte und doch wärme ich mich nicht sondern warte, bis der Frühling da ist. Und der Boden besser wird.