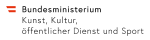MITGLIEDER
Text von:Ingrid Zebinger-Jacobi
Grünes Licht
Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes
before us. It eluded us then, but that’s no matter – to-morrow we will run faster,
stretch out our arms farther … And one fine morning – So we beat on, boats
against the current, borne back ceaselessly into the past. (Fitzgerald, The Great Gatsby)
Das Ende
Das Totenglöcklein des kleinen Ortes hatte getschingelt und geklingelt, jemand lag kalt und stumm in seiner Kiste. Die Witwe, die Helga hieß, saß auf der Küchenbank, die Küche und das Wohnzimmer wimmelte von Cousinen, Cousins, Neffen und Nichten und Enkeln. Ihren Kaffee hatte sie viermal gezuckert, ein ums andere Mal vergessend, dass sie bereits ihre zwei Löffel Zucker darin verrührt hatte. Sie hatte den Kaffee auch noch gar nicht probiert, inzwischen war er kalt geworden. Während des Begräbnisses hatte sie nichts verstanden, nur der Pfarrer hatte immer wieder „Frieden!“ und „Ruhe!“ gesagt. Genau das wollte sie für sich selbst. Für ihn auch, ihren Mann, aus Gewohnheit, aber er hatte ihn jetzt ja. Oder nicht.
Ihre älteste Tochter, die Petra, hatte sie nach dem Leichenschmaus hier auf die Küchenbank gesetzt. Jetzt lachte ein junges Mädchen im Wohnzimmer. Ihr Lachen blieb silbrig in der Luft hängen. Die alte Frau hielt sich daran fest, als sie aufstand, um den Kaffee in den Ausguss zu schütten. Sie blieb bei der Spüle stehen, rieb mit einem Geschirrtuch an einem Fleck auf ihrem Kleid. Hatte jemand den Fernseher eingeschaltet? Nachrichten. War es schon Abend? Dann war das Grab wohl schon zugeschaufelt. Sie spürte die Erde nass und schwer auf ihn fallen, als ob es ihr selbst passieren würde. Platsch. Mit Steinen darin, kleinen runden und kantigen. Sie setzte sich wieder an den Tisch.
Sie hatte sich auf den Tagen ausgeruht, den langen und kurzen. Auf der Gewissheit, dass immer eine kleine Stunde auf die andere folgen würde, und dann wieder ein Tag auf den nächsten. Der Einsamkeit sah sie mit einer gewissen Genugtuung entgegen. Das Haus würde sich leeren, die Verwandten gehen, die Tochter alle paar Tage vorbeischauen, sich vergewissern, dass sie noch da war, noch am Leben, noch immer alt, nicht tot. Sie hatte sich bereits adoptieren lassen von den Jungen. Es würde Stille in den Zimmern herrschen, den Fernseher würde sie nicht oft einschalten. Aus Gewohnheit würde sie noch eine Zeitlang für zwei kochen, mittags und abends dasselbe essen, oder die Hälfte stehen lassen, einen Tag im Kühlschrank aufbewahren, vielleicht zwei, dann wegwerfen. Keinen Sonntagsbraten mehr, so etwas kocht man nicht für einen. Sie stützte die Ellbogen auf den Küchentisch und fuhr sich mit den Händen durch die kurze Dauerwelle. Haare tönen, für wen? Die Luft roch nach nasser Erde, das Atmen fiel ihr schwer. Sie atmete Erde. Hustete. Der Tod, das klang hohl, Tod. Vertraut auch. Ich werde einsam sein, allein, fast immer, dachte sie, nickte innerlich dazu. Das war schon eine Aufgabe. Brauchte sie mehr?
„Brauchst du noch etwas?“ Petra stand im Pyjama vor ihr, sie würde in ihrem alten Zimmer schlafen, eine Zeitlang. Die Frau am Küchentisch schüttelte den Kopf. Eigentlich nicht. Sie stand auf um ebenfalls schlafen zu gehen.
Als sie die Decke über sich breitete, fand sie sie schwerer als sonst. Komm, schlaf jetzt. Das sagte ihr Mann, der war doch wieder da, war nicht am Friedhof. Absurd. Friedhof, doch nicht du. Schlaf. Mühsam drehte sie sich auf die Seite. Das Bett war neu, die Matratze federte sanft. Für seinen schmerzenden Rücken, für ihre kaputten Bandscheiben und gerade erst gekauft, jetzt war das Bett zu groß und wohin mit seinen Hemden? Das neue grüne und das mit den roten Streifen, den dünnen.
„Caritas,“ sagte die Petra zwei Wochen später, „weg damit, das tut dir nicht gut, die Sachen zu sehen.“ Mit großzügigem Griff holte sie die Sachen ihres Vaters aus dem Kasten, stopfte den Inhalt der zwei, drei Regale in große schwarze Plastiksäcke, lud sie ins Auto, um sie zur Sammelstelle zu bringen. Helga setzte sich, irgendwie dankbar und wie gelähmt gleichzeitig, auf leise Art unwillig, auf den Beifahrersitz, stellte einen der Säcke zwischen ihre Beine. Petra hatte schon recht. Aber es tat Helga leid um seine Sachen.
Petra fuhr schon eine Weile hinter einem Traktor her. Kurvig, wie die Strecke hier war, war es schwierig zu überholen. Eng war sie auch, die Straße, die durch Felder und einen Wald führte. Helga war froh darüber, dass es so langsam voranging. Sie hatte keine Eile damit, anzukommen. Der Sammelplatz, auf dem allerlei Container standen, war in der nächsten größeren Gemeinde. Es roch dort nach Teer und es stank immer aus der großen Altmetalltonne, nach süßlich vertrocknetem Bier und ranzigem Öl aus leeren Fischkonserven. Jetzt, im Sommer, würde es dort besonders schlimm stinken. Sie selbst würde also die Säcke mit den Hemden und Hosen ihres Mannes in den Container für Altkleiderspenden fallen lassen. Helga war überrascht, wie ruhig sie dennoch dasitzen konnte, wie resigniert. Das graugrüne Licht des Morgens hing an den Zweigen des Waldstückes, das sie eben durchfuhren. Helga ließ das Fenster hinunter, hielt ihre Hand hinaus. Noch war es kühl. Einen Moment lang wünschte sie sich, sie hätte den Führerschein damals doch gemacht. Das Auto, in dem sie und ihr Mann die letzten zehn Jahre gefahren waren, stand unbenutzt im Halbdunkel der Garage. Es wunderte sie, dass noch keines ihrer Kinder danach gefragt hatte. Vielleicht würde es Petras Sohn bald zu Schrott fahren.
Der Traktor bog jetzt schwerfällig nach rechts ab und Petra beschleunigte. Helga sah zu ihrer Tochter hinüber, deren Gesicht wieder diesen Ausdruck angenommen hatte, einerseits konzentriert, andererseits geistesabwesend. Müde. Die Nachtdienste im Spital. Der Wald löste sich nun auf, ging in Wiesen und Felder über, die Welt war eine Patchworkdecke aus Grün und Gold. Da waren Dächer. Eine Tankstelle. Dort vorne bei dem Kreisverkehr war die Sammelstelle. Petra tastete mit ihrer Rechten nach der Sonnenbrille, setzte sie rasch mit einer Hand auf, bog ab. Sie hielt direkt vor dem Altkleidercontainer, stieg aus, öffnete den Kofferraum. Helga löste ihren Gurt, stand mühsam auf. Petra warf bereits den ersten Sack in den Container, dann den zweiten. Helga hätte es ihr sagen müssen. Sie sah ihrer Tochter über das Autodach hinweg zu. Sie hätte es ihr sagen müssen, dass sie es selber machen wollte. Der dritte Sack ließ sich nur mit Mühe hineinstopfen, Petra zog ungeduldig am Griff des walzenartigen Deckels. Der letzte Sack, der, den Helga noch in der Hand hielt, würde keinen Platz mehr haben. Petra nahm ihn ihrer regungslos dastehenden Mutter ab und stellte ihn neben dem Container auf den dreckigen Asphalt. Dort lagen auch Glassplitter. „So,“ sagte sie, abschließend, „Brauchst du noch etwas aus dem Supermarkt? Ich habe Zeit.“ Petra blickte auf die Uhr, unterdrückte ein Gähnen. Helga räusperte sich, versuchte zu sprechen. „Nein, danke,“ sagte sie schließlich. Plötzlich wollte sie nichts so sehr, als wieder daheim zu sein. So weit weg wie möglich von dieser Tochter. Und der letzte Sack blieb einfach dort stehen, in der jetzt schon heißen Sonne. Helga fühlte sich missbraucht. Sie würde Petra sagen, dass sie nicht noch eine Nacht bei ihr schlafen müsse.
Abends, vor dem leeren Kasten, nachdem Helga alle Regale abgestaubt hatte, merkte sie, dass da kein Unterschied war. Ihr Mann war trotz allem noch da. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Sie war noch da. Der Sommer entfaltete sich, wie von selbst.
Der Sommer
Sie war wieder frei, allein. Wenn sie ihre Freiheit jetzt wieder aufgeben würde müssen, dann für den Tod, irgendwann, bald vielleicht, vielleicht in zwanzig Jahren. Wie sollte sie auch die Zeit aufhalten, die ihr jetzt feindlich gesinnt war, ihr höhnisch täglich ihre Stunden vorführte und ihr zuflüsterte: da, in dieser oder in jener Stunde, in einer von ihnen bestimmt, wirst du sterben. Vielleicht nicht heute, vielleicht aber morgen oder in drei Wochen. Wenn ihre Nachbarn sie besuchen kamen, sie ihnen Kuchen auf den Tisch stellte und sich mitleidig anblicken ließ, dann meinte sie, sie denken zu hören, laut und deutlich, warum ist sie noch da? Wann geht auch sie? Wann bestellen die Kinder die Planierraupen, um das hässliche alte Haus wegschieben zu lassen? Hinter jedem Marmorkuchenbröselchen, das von den gierigen Mündern ihrer Besucher fiel, wenn sie in die großzügig abgeschnittenen Stücke bissen, saß ein Vorwurf, ein Missstand. Die Tage, an denen niemand kam, waren nach einiger Zeit die besten.
Sie ließ sich die Haare wieder lang wachsen. Nach jedem Kind hatte sie weniger Haare gehabt, weshalb sie jetzt ein dünnes graues Zöpfchen um fast schon kahle Stellen schlang und feststeckte. So sparte sie Geld, denn zum Friseur ging sie nicht mehr. Sie sparte auf ihr Begräbnis, wollte den Jungen nicht zur Last fallen. Fast war sie versucht, den Saal selbst im Gasthof zu reservieren, Würstel mit Saft für alle. Vielleicht würde die Blasmusik spielen, der Kirchenchor singen? An den Tagen, die lang waren, den einsamen Tagen, lauschte sie, ersehnte sie ein Klopfen, ängstlich und zugleich aufgeregt wie ein junges Mädchen. Das Klopfen einer knöchernen Hand, den Ruf des letzten Liebhabers, das Rasseln der Knochen unter der Kutte. Es war dieses Klopfen an der Tür, das sie erwartete wie einen Kuss. Den rauen Kuss hölzerner Lippen.
Er war ihr vertraut, seit jeher, seit den langen, grünen Morgenstunden allein zuhause, als sie jung war. Hinaus auf die Wiese, in den Wald. Da konnte sie sich zurücklehnen, in ihre Eltern, in die Vertrautheit ihres Zimmers, die Ecke mit den Büchern. Die Nachmittage mit Freundinnen, die sie kannte wie ihr eigenes Spiegelbild. Wo waren die alle hin?
Und jetzt wartete er auf sie, der Sensenmann. Vielleicht saß er beim Dorfwirt, hatte ein Bier und ein Gulasch vor sich stehen, zählte die Fliegen am Fenster. Danach würde er vielleicht über die Wiese zu ihr gestapft kommen, ihr einen grünen Strauß aus hohem Gras mit seiner Sense abschneiden. Vielleicht würde er sich dann von dort hinter ihrem Garten anschleichen, sich im hohen Gras verstecken, mit der Absicht, ihr eine Überraschung zu bereiten.
Dort hinter dem Garten begann die wahre Freiheit. Sie ließ ihren Blick über die Wiesen schweifen, während sie die Hintertür öffnete, hinausging, zwei Stufen hinunter. Nichts bewegte sich dort, nichts außer dem wogenden Gras, nichts klang von dort, außer dem knusprigen Gesang der Grillen und Heuschrecken.
Hinaus. Dorthin zog es sie, in den Wald. Nur ihr Knie, das machte nicht mehr mit. Lange Spaziergänge, das war vorbei. So wie jetzt saß sie nun oft im Garten, nachdem sie ihr Gemüsebeet gejätet hatte, Unkraut ausgerissen hatte. Die eine oder andere noch warme Tomate in einem Korb neben sich liegen hatte, was ihr ein Gefühl von Zufriedenheit gab. Ein Gefühl, das anders war, aber doch einem Gefühl ähnelte, das sie, als sie jung war, oft empfunden hatte. Diese Hoffnung, diese Rastlosigkeit im Bauch, in der Magengegend. Die Möglichkeiten des Jungseins. Mit siebzehn und sechzehn Jahren hatte sie nicht nur geahnt, sondern gewusst, mit Bestimmtheit: da war noch etwas, etwas würde kommen, vielleicht war es hinter diesem Gebüsch versteckt, oder doch am Dachboden? Und was war gekommen außer all diesen Tagen. Ein Tag nach dem anderen, kurze, lange. Der Himmel war blau gewesen und die Wiese so unfassbar grün. Sie blickte hinaus aus ihrem Garten, überblickte Felder und Wälder. Der Kirschbaum über ihr raschelte dazu mit seinen Blättern. Die Blätter des Baumes sahen kühl aus, vergnügt. Alles wie immer. Da steckte noch ein Nagel im Kirschbaum, da war eine Girlande daran befestigt gewesen. Kinderfeste. Geburtstagsfeste. Sie legte ihre Finger darauf, spürte den Rost daran. Alles wie immer. Grün wie immer. Sie stand auf, nahm ihre Tomaten, ging ins Haus, wie um sich zu bestrafen.
Sie stand vor dem Wohnzimmertisch, auf dem sich Alben stapelten. In denen die Fotos ihren Ringelreihen tanzten mit einer früheren Version ihrer selbst, einer grauen Frau aus den Jahren, bevor die Farbe erfunden worden war. Da war sie, grau und weiß, da war ihr Mann, grau und weiß. Ihre Kinder, zunächst grau und weiß, dann in siebzigerjahregrellen Farben. Als diese Fotos gemacht worden waren, war es draußen, in diesem Garten, den sie jetzt von ihrem Fenster aus sehen konnte, entweder windig oder regnerisch gewesen, hatte die Sonne geschienen, waren Wolken vorbeigetrieben, Autos auf der Straße vorbeigefahren. Sie erinnerte sich deutlich daran, die Welt war immer schon bunt gewesen. Warum also schien es ihr jetzt so, während sie auf ihre letzte Affäre wartete, auf das Anklopfen des hölzernen Knochenmanns, dass die Welt zurück ins hellgraue Dunkel ihrer frühen Fotos gerutscht war, dass damals alles bunt gewesen, jetzt aber alles an Farbe verloren hatte? Es war fast so, als zeigte der Spiegel eine graue Version ihrer selbst, die sie so nicht annehmen wollte. Sie wollte es vergessen, wollte vergessen, dass sie einmal die Besitzerin von Farbe gewesen war.
Wieviel Zeit in all diesen Alben kondensiert war. Da. Dieses Foto. Sie nahm es vorsichtig aus dem Album. Es zeigte sie selbst mit ihren Kindern. Müde lächelnd, ein Baby im Arm, ein Mädchen, das sie umarmte, das war die Petra. Da war auch ihr zweites Kind, ein Sohn, mit engelgleichem Haar, einem süßen Gesicht. Rau, haarig, fremd war er geworden, obwohl er sie einmal wöchentlich zum Supermarkt mitnahm.
Mit Sehnsucht dachte sie an ihre Babys zurück, die ihr nun als etwas Eigenständiges erschienen, etwas von diesen Erwachsenen, die sie nun waren, Unabhängiges. Sie schwebten wie Putten über der Realität ihrer Kinder. In rundlicher barocker Pracht. Pausbackig. So vielversprechend. Da war so viel Hoffnung gewesen. Und sie waren so normal geworden. Dickbäuchig. Schwitzend.
Wenn sie eines Tages das Klopfen hören, die Tür öffnen, ihn hereinlassen, dem Knochenmann ein Stück Marmorkuchen auf einen Teller legen würde, schließlich mit ihm gehen und die Tür im Hinausgehen hinter sich zufallen lassen würde, dann würde ihre älteste Tochter kommen, mit ihren Müllsäcken. Sie würde das Leben ihrer Mutter in ein paar Säcke stecken und in den Restmüll werfen, oder für gute Zwecke spenden.
Eine Fliege schwirrte um Helgas Kopf, setzte sich aufs Fensterbrett. Sie griff hinter sich, nahm die Fliegenklatsche. Geübt, mit einem raschen Schlag, erlegte sie das Insekt. Als sie die Überreste desselben mit einem Taschentuch aufhob, fiel ein Fliegenbein heraus und auf den Boden. Sie fand es nicht, als sie danach suchte. Mit einer gewissen Verzweiflung sah sie draußen die Nacht ankommen.
Der Abend warf gleichgültig mit seinen letzten Sonnenstrahlen um sich. Nichts war sanft in der Welt, die ihr der Tod ihres Mannes übrig gelassen hatte. Sie lebte noch, funktionierte noch, die alte Maschine. Sie mähte jetzt den Rasen selbst, das hatte immer ihr Mann gemacht. Die Rosen, diese masochistischen Pflanzen, schnitt sie selbst zurück. Dann wuchsen sie noch mehr, noch kräftiger, streckten ihre zarten Blätter ermutigt der Sonne entgegen. Das war ganz anders bei Menschen. Sie fühlte sich zurechtgestutzt. In ihrer Eigenart entblößt, entlaubt.
Im Garten trat gerade die Nachtschicht der Insekten ihren Dienst an. Es war genau wie damals, Helga fühlte sich nicht anders. Es war so ruhig gewesen, im Haus ihrer Eltern, dass sie die Schnecken an einem Blatt fressen hören konnte, nachdem sie schleimig aus der Erde gekrochen waren, das leise Glucksen der Erde nach einem Regenschauer. Die Hornissen, die halb wahnsinnig gegen die Wand geflogen waren. Hummeln, die am Lavendel geschlürft hatten, sich mit Bienen abgewechselt hatten. Das alles war weg. Und, dachte sie, sie merkte es mit Schrecken und einer gewissen Genugtuung: das war damals schon alles gewesen. Mehr war da nicht gekommen, nichts hatte hinter dem Gebüsch auf sie gewartet. Nichts sonst hatte sie mehr bedrängt, so sehr nach Leben gelechzt, als dieser oder jener grüne Sommertag. Sie streckte sich, ihr Rücken schmerzte, die Augen brannten. Es war still im Haus. Ihr Wecker tickte hörbar. Sie legte sich schlafen. Träumte.
Eine staubige Straße führte durch eine Steppe. Dann in die Berge. Staubige, trockene Wüstenberge. Sie war nicht allein. Mit ihr waren andere Frauen, die Kopftücher trugen, auf der Flucht. An ihrer Hand hielt sich ein fremdes Kind fest. Mama, sagte es und riss die Augen auf, es hatte Angst. Stumm blickte sie es an. Wer bist du, hörte sie sich fragen. Sie stolperte über einen Felsbrocken, der mitten am Weg lag. Im Fallen sah sie wie sich langes, seidiges Gras in Büscheln langsam, langsam bewegte. Im Wind, der aus Osten zu wehen schien. Sie fühlte ihn auf ihrer verschwitzten Haut. Sie rutschte und fiel und klammerte sich an etwas fest. Denn neben dem Weg, da war ein Abgrund. Der war ihr zunächst nicht aufgefallen. Rötlicher Sand rieselte auf ihr Haar. Das Kind sah sie an und ging dann einfach weiter. Alle gingen weiter. Sie sah das letzte Paar staubbedeckter Schuhe vorbeigehen. Dann sah sie nur noch den Himmel, blau und ebenfalls staubig, denn da zog ein Sandsturm herauf, der ihre Kleider wehen ließ, ihr die Augen zuhielt und sie mit sich hinauf in die Höhe riss.
Zwei Stunden später war sie wieder angezogen, stand in der Küche und hörte der Kaffeemaschine beim Brodeln zu. Sinnlos, auch nur zu versuchen zu schlafen. Während sie auf den Kaffee wartete, sah sie ihrem Halb-Drei-Uhr-Nachts-Spiegelbild im Küchenfenster in die undeutlich erkennbaren Augen, starrte sich unzufrieden an. Dann löste sie sich aus einer ihrer Häute, warf sie in den Biomüll, fuhr sich mit der linken Hand durch die offenen, grauen Haare, strich sie zurecht. Richtete sich auf, atmete leichter.
So konnte sie dem Gevatter Tod ins Auge blicken, der sie schon immer kannte, seit den grünen Nachmittagen, dem sie nichts vormachen konnte. Der kurz vorbeigeschaut hatte, als sie ins neue Haus eingezogen war, als es endlich fertig gebaut und frisch gebacken weiß gestrichen dagestanden war. In diesem Haus, das jetzt nicht mehr neu war, wartete sie seither auf ihn. Sie würde ihm die Hand kräftig schütteln.
Sie setzte sich und las eine zwei Wochen alte Zeitung, die ihr Sohn bei ihr vergessen hatte. Der Kaffee schmeckte ihr. Und draußen wurde es nun wirklich langsam Morgen.
Gulaschkochen
Später an diesem Morgen, bevor es zu heiß wurde, ging sie einkaufen, denn sie hatte plötzlich Gusto auf ein Gulasch. Wie durch ein Wunder hatte in ihrem Dorf noch ein Greißler überlebt, dort konnte sie das Notwendigste kaufen. Rindfleisch hatte sie in der Tiefkühltruhe. Keine Zwiebeln, kein Paprikapulver. Sie würde eine große Menge von diesem Gulasch machen, im Suppentopf. Die Sache auskühlen lassen, in kleine Plastikbecher abfüllen und einfrieren. Sie würde wohl auch Knödel machen müssen. Serviettenknödel. Ein Anker, solche Verrichtungen. Mal sehen. Germ brauchte sie. Hoffentlich hatten sie frische im Geschäft. Knödel ließen sich auch gut einfrieren. Knödel mit Ei, ein wenig grüner Salat. Ohne Zweifel, sie hatte Hunger.
Sie trat vor ihr Haus und die Sonne war zu hell. Es war heiß. So schnell sie konnte, wechselte sie auf die etwas schattigere Seite der Straße. Sie fühlte sich beobachtet, der Welt ausgesetzt und, schlimmer, den Nachbarn. Da bewegte sich eine Gardine, dort grüßte eine alte Bekannte. Wie wonnig kühl ihr Haus war, wie wunderbar hoch die Hecke um ihren Garten. Während sie die paar hundert Meter den Berg hinaufkeuchte, wünschte sie, sie wäre daheim geblieben. Rechts von der Straße der Friedhof. Sie dachte daran, kurz bei ihrem Mann vorbeizusehen. Das tat sie manchmal. Sie hatte auf seinem Grab nur Pflanzen gesetzt, die die langen Sommertage ohne viel Wasser überstanden. Kleine, borstige Pflanzen mit Nadeln. So musste sie nicht mit den anderen Witwen täglich abends um die Wette gießen. Sich um die Friedhofsgießkannen streiten, sich bei der Wasserleitung anstellen. Darüber, über Helgas Versagen, redeten die anderen wahrscheinlich, während sie darauf warteten, ihre Gießkannen zu befüllen. Dem Tod die Stirn bietend, ihre Pflicht erfüllend, den Toten gegenüber, die mit Petunien, Stiefmütterchen, oder diesen kleinen gelben oder orangen Blumen, die entsetzlich stanken, wenn man sie beroch, besänftigt wurden, beschworen wurden, in ihren Gräbern zu bleiben. Jetzt, um diese Zeit, war der Friedhof leer, nur eine graue Katze streifte zwischen den Gräbern und frischen Erdhaufen herum. Der Schnitter war fleißig gewesen diesen Frühling. Die Friedhofsmauer endete. Daneben eine Wiese. Dort war Raum für neue Gräber. Sie setzte sich auf eine Bank, die der Tourismusverein der Umgebung für die nicht existenten Sommerfrischler aufgestellt hatte. „Mach Rast wozu die Hast“ war darauf eingekerbt, ohne Satzzeichen. Nicht mehr weit bis zum Geschäft.
Sie ließ den Blick über das Tal schweifen, in dem der Ort sich eingenistet hatte. Hier hatte sie sie vor Augen, die Freiheit, in Form des dunklen, satten Grüns des Waldes, der ihr aber nicht mehr gehörte, den sie nur noch in ihren Gedanken erreichen würde. Sie wusste, wie es dort jetzt aussah. Vielleicht fehlte inzwischen der eine oder andere Baum, vielleicht war inzwischen ein Lieblingsweg überwuchert, mit Himbeerranken und Heidelbeerbüschen und Farn. Jungen Bäumen. Aber im Grunde änderten sich Wälder so wenig wie Menschen.
Die schmale Birke, die neben der Bank ein einsames Dasein fristete, spendete ihren schütteren Schatten, ein wenig zaghaft stand sie zwischen Helga und der Vormittagssonne, die die alte Frau an ihre Mission erinnerte: du musst noch einkaufen gehen. Ich muss gar nichts, dachte Helga, die schwitzte. Sie hatte Strumpfhosen an, trotz der Hitze. Im Haus war ihr immer kalt, sie hatte vergessen, sie auszuziehen. Helga raffte sich auf.
Sie versuchte, nicht daran zu denken, was gerade mit ihrem Mann passierte. Tat es dann aber doch. Sie schüttelte sich, Schweißtropfen standen ihr auf der Stirn, als sie sich vom Friedhof abwandte. Dort würde sie noch einmal vorbei müssen, auf dem Rückweg. Sie ging die letzten paar hundert Meter bis zum Greißler halb gezogen von der Vorstellung, dass ihr Mann neben ihr ging, sie an der Hand hielt. Ganz ähnlich so, wie sie es manchmal bei jungen Paaren sah, die glaubten, das ebenso gut zu können wie sie beide damals, sie und ihr Mann. Und wahrscheinlich konnten sie das auch.
Sie tauchte in die Kühle des kleinen Geschäfts ein. Der Geruch eine Mischung aus Essiggurkerln, Brot, Äpfeln, erdigen Kartoffeln, verschiedenen Verpackungsmaterialien, aber hauptsächlich Karton und natürlich Wurst, frisch aufgeschnittener Extrawurst. Fliegenstreifen hingen von der Decke, ein Fliegenvorhang aus bunten Plastikstreifen raschelte am Eingang, als sie ihn beiseite strich, um ins Innere zu kommen. Da war das Summen des Kühlschrankes und der eisumrandeten altmodischen Tiefkühltruhe, in der Eislutscher für die Dorfkinder lagerten, neben Erbsen und Schollenfilets. Früher hatte sie das eine oder andere ihrer Kinder dabei gehabt beim Einkaufen. Immer hatten sie etwas bekommen, eine Wurstsemmel, einen Eislutscher mit grell leuchtendem pinken Stiel, mit Kaugummi darin. Kindersehnsüchte, so heftig wie vergänglich. So süß wie ein Dreh und Trink.
Hier wurde man noch bedient. Helga bestellte von der dicken Frau, die hinter den angeschnittenen Würsten stand. Sie war froh, dass außer ihr keine Kunden da waren. Sie war auch froh, dass die dicke Frau mit dem Akzent nicht gut genug Deutsch konnte, um viel Smalltalk zu machen. Besser noch, sie kannte Helga nur von ihren kleinen Einkäufen, fragte nicht zu viel, fragte nicht nach ihren Kindern, fragte nichts weiter, als nach ihrem Befinden. „Gut, danke.“, sagte Helga. „Und wie geht es Ihnen?“ Ein Monolog folgte, es ging um eine Katze und einen Mann und seinen Fußball. Helga hörte nicht zu, begutachtete Zwiebeln, legte alles in den Korb. Kaufte Semmeln und Germ. Petersilie brauchte sie nicht, die wucherte wie Unkraut in ihrem Garten. Mit einer gewissen Vorfreude dachte die alte Frau daran, wie sie dicke Büschel davon mit ihrer Gartenschere abschneiden würde. An den frischen Geruch. Die saftigen Blätter. Wie grün und kühl. Für die Knödel. Sie bekam ihr Wechselgeld. Verabschiedete sich und ging, die Kühle und die Gerüche hinter sich lassend. Und die dicke Frau.
Bergab ging es leichter, musste sie nicht rasten, sie blinzelte im grellen Licht der Sonne, die schon nahe am Mittag stand. Gut war, dass um diese Zeit alle Alten des Dorfes in ihren Küchen standen und kochten, keine Zeit hatten, aus ihren Fenstern zu blicken. Die hier machte wohl Schnitzel, die dort Backhendel, Fettdünste waberten in der schwülen Luft. Bald würden die noch lebenden Ehemänner nach Hause kommen und nach Fleischgerichten krähen.
Ein Auto fuhr vorbei, dann noch eines. Helga überquerte die Straße, öffnete das Gartentürchen, ging die Stufen hinauf und tauchte ein in das Halbdunkel des Vorzimmers, wo im Schuhkästchen zwei Paar Schuhe ihres Mannes überdauerten, die ihre Tochter übersehen hatte.
Die Schwüle schwappte hinter ihr her über die Schwelle, drang ein paar Schritte weit in ihr Heim ein, bevor sie sie aufhalten konnte, die Eingangstür schloss. Helga atmete schwer nach dieser Anstrengung, war froh, zumindest die Helligkeit des Sommermittags ausgesperrt zu haben. Sie setzte sich, massierte ihre geschwollenen Knöchel, wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von Stirn und Wangen. Dann stand sie auf, nahm ihren Korb, ging in die Küche.
Der Korb stand auf dem Tisch. Helga setzte sich erst einmal hin, um auszuruhen. Sie würde später kochen. Jetzt aß sie eine Extrawurstsemmel mit Gurkerln, die sie sich im Geschäft hatte machen lassen. Später würde sie alle Fenster öffnen, dann würde sie auch kochen. Noch war da ein wenig von der Morgenkühle, die Fensterbalken waren geschlossen. Mediterranes Halbdunkel herrschte im ganzen Haus, während langsam aber stetig Staub fiel, die Zeit in kleinen Mengen ausmaß. Das Fleisch lag zum Auftauen in der Spüle, in einer Schüssel, die sie mit einem Suppenteller zugedeckt hatte. Die Zwiebeln würde sie in die Küchenmaschine stecken, die sie zu Weihnachten bekommen hatte, vor zwei Jahren. Oder drei. Noch von ihrem Mann. Sie würde trotzdem weinen müssen. Vom Zwiebelschneiden. Sie musste sich erst etwas ausruhen, legte sich aufs Sofa im Wohnzimmer.
Gegen drei Uhr nachmittags erwachte sie, wohlig überrascht von so viel Schlaf. Mühsam richtete sie sich auf. Sie sammelte sich, ging dann zur Hintertür und setzte ihren Sonnenhut auf. Draußen war es heißer und schwüler als am Vormittag. Sie nahm die Gartenschere und ihren Korb. Doch es war nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Die Petersilienbüsche standen matt in der Sonne, da war nichts von dieser knackigen Kühle, an die sie im Geschäft gedacht hatte. Nein, sie hatte nicht vergessen, zu gießen. Die Erde war feucht. Aber diese Sonne. Eine dumpfe Schwüle. Überhaupt war kaum ein Laut zu hören, alle hatten sich in ihren Häusern verkrochen. Nur die Grillen kämpften ihren kleinen Kampf um Partner und um Territorium oder weswegen immer sie vor sich hin geigten. Staubig und schwer hing eine Dunstschicht über dem Horizont, die sich bläulich mit dem Wald am Hügel vermischte, den Nachmittag eintrübte. Quellwolken schoben sich über die fernen Berge. Es würde ein Gewitter kommen. Helga schnitt ein Bündel Petersilie ab.
Sie ging, gebeugt unter so viel Hitze, wieder ins Haus und in die Küche, um dort die Petersilie in ein Glas kaltes Wasser zu stellen. Die Küchenmaschine schnitt Zwiebeln. Jetzt war es Zeit, das Fenster zu öffnen. Alle Fenster zu öffnen. Egal, ob es heiß war. Sie röstete, sie rührte. So vergingen Stunden und sie war überraschend glücklich. Ah, das wäre früher gleich alles weg gewesen. Blubb machte das Gulasch, zustimmend. Hinter ihr liefen ihre Kinder herum. Und ihr Mann holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Magst du auch eines, fragte er sie. Ja, sie wollte. Sie streckte ihren kühlen, alten Arm aus und griff nach einer Flasche, das tat sie wirklich. Die alte Frau rührte und rührte, das Gulasch köchelte und köchelte. Die Knödel waren schon fertig und lagen noch dampfend in einer Schüssel. Sie waren ihr ein wenig zu weich geraten. Das würde keinen stören, es war alles völlig egal. Sie kochte mit Verzweiflung und mit Ausdauer.
Der Gulaschduft zog durch ihr Haus, flog durch die offenen Fenster hinaus. Wirbelte um die Bäume und mischte sich in den aufkommenden Wind. Weit hinter der wogenden Wiese sog diesen Duft ein dunkler Mann ein, der Gulasch liebte. Gulasch und Bier. Er kam näher, schritt über die Wiese, schlich in den Garten und blieb unter dem Küchenfenster stehen. Helga sah ihn nicht. Da war auch nichts zu sehen. Er rasselte erfreut mit den Knochen, schleckte sich die hölzernen Lippen, schnupperte gierig und bedauernd. Denn das Essen war nicht für ihn. Es war für eine alte Frau, die eine kleine Portion für später in eine Schüssel schöpfte, Plastikdosen bereitstellte. Die Knödel zerschnitt sie in Scheiben und steckte sie in Plastikbeutel, die sie mit etwas zittriger Hand beschriftete. Dann setzte sie sich hin, vor den vollen Teller und hatte überhaupt keinen Hunger mehr.
Ein kalter Windstoß durch das offene Fenster ließ sie aufblicken. Der Nachmittag war verraucht. Sie war so beschäftigt gewesen, dass sie völlig überrascht wurde von einem Abend wie aus ihrer Kindheit, von gelblichem Licht erhellt, das zwischen Wolken schräg hervorstieß, messerscharf den Garten in Kontraste zerteilte. Helga beugte sich mühsam hinaus aus dem Fenster, halb sitzend, streckte sich. Da waren Quellwolken am Himmel, vielleicht schon ein Stern. Tumult, ein Gefühl von Unruhe, Rastlosigkeit, im Himmel und überall. Auf einem Feld, nicht weit hinter ihrem Haus, fuhr ein Traktor hektisch herum. Morgen würden die Mähdrescher kommen, alles an sich reißen. Das heißt, das Getreide würde geerntet werden, sollte das Gewitter, das sich ankündigte, mit dumpfem Grollen, dunklen Wolken und kaltem Wind, das Feld nicht doch noch im letzten Moment flachlegen.
Helga spürte die Erregung in der Luft, die Ansammlung dunkler Gedanken, die mit dem aufkommenden Wind in ihr Haar fuhren, ihr die verschwitzten Glieder kühlten. So ähnlich war das damals gewesen, in diesem Sommer, als das Grün sie verschlungen hatte, seine Tentakel nach ihr ausgestreckt hatte. Sie in der Wiese gelegen war, das Leben in sich eingesaugt hatte. Das Grün, es hatte sie angegrinst. Sie weitergelockt. Immer weiter. Bis hierher. Bis zu diesem Moment.
Gut, dass die Luft gerade so kühl war. Bald würde es regnen. Sie setzte sich an den Tisch, sah angestrengt hinaus, vor ihr ein Teller mit lauwarmem Gulasch. Eine Nachbarin lief panisch um ihr Haus, zupfte Wäsche von der Leine, warf sie in einen Korb, lief damit ins Haus, als die ersten Tropfen vereinzelt und schwer ins Gras fielen. Der Wind warf die Tür hinter der Nachbarin zu. Die Erde sog am Himmel. Nun begann es wirklich zu regnen. Fast fühlte Helga sich wieder jung, während der Wind das Wasser peitschte, ihrem Kirschbaum in den Hintern trat und sonst allerlei Unfug trieb. Wie ein junger Hund. Es war eine Freude, zuzusehen. Sie stand auf, um all die offenen Fenster zu schließen, diverse Türen waren schon zugefallen, hatten sich dem Wind ergeben mit lautem Knall.
Nur das Fenster in ihrem Schlafzimmer ließ sie offen, es lag im Windschatten. Ihr Garten wurde vom Sturm hin und her geworfen. Büsche, Bäume, Erinnerungen, Wasser, all das in Helgas Hirn, kleingeschnippelt, zusammengeballt, aufgekocht, aufgeschäumt, weggeworfen, hinaus in die Gewitternacht. Blitze zuckten. Das hatte die Welt verdient. Gib es ihr, dachte Helga, hätte sie fast laut gerufen. Niemand hätte sie gehört, in diesem Krachen und Scheppern, das die Fensterscheiben machten, jedes Mal, wenn der Donner über die Hügel rollte und polterte. Nach einer halben Stunde ging der wilde Tanz immer mehr in einen einfachen, biederen Regen über, einen nichtssagenden.
Die Erde hatte bekommen, was sie ersehnt hatte, wonach sie verlangt hatte. Der Regen hatte es ihr besorgt, sozusagen. Für den Augenblick, das wusste Helga, gluckste die Erde glücklich, ein wenig dümmlich. Wie geduldig und wunderbar dumm sie war, wie empfänglich und fruchtbar. Viel geduldiger als Helga und unsterblich. Egal wohin sie geschaufelt wurde, sie bestand fort. Und so wird es auch mir ergehen, dachte Helga. Irgendwann schaufeln sie auch mich weg, mitsamt der Erde. Ein Fingerknöchelchen auf einer dicken, fetten Schaufelladung Erde.
Wie grün am Morgen alles sein würde. Wie erfrischt.
Das grüne Licht durch die Kirschbaumblätter.
Helga konnte es schon sehen.